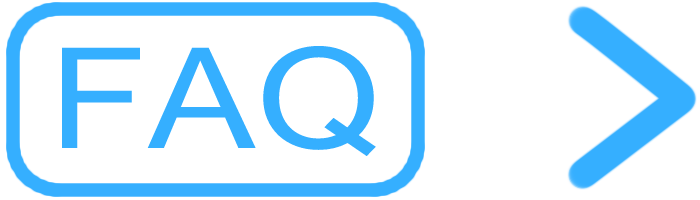Die Kirchensteuer ist unter der Hoheit die Kantone. Entsprechende kantonale Steuergesetze regeln die Einzelzeiten zur Kirchensteuer. Im Kanton Bern regelt das vom Grossen Rat beschlossene Berner Kirchensteuergesetz die Angelegenheit.
Im Kanton Bern sind die Kirchensteuern für Privatpersonen, auch natürliche Personen genannt, relativ tief. Dies hängt mit zwei wesentlichen Standortfaktoren der Evangelisch-reformierten Kirche (kurz Reformierte Kirche) und der Römisch-katholischen Kirche Bern zusammen.
Der erste Punkt ist die obligatorische Kirchensteuer für Unternehmen. Der Kanton Bern nutzt eine hier bei der Kirchensteuer Basel genauer beschriebene fehlende Detaillierung in der Schweizer Bundesverfassung, um darauf die Kirchensteuer für juristische Personen zu begründen.
Der Verwendungszweck der Kirchensteuern der juristischen Personen ist im Kirchengesetz zwar eingeschränkt „Die Erträge aus den Kirchensteuern der juristischen Personen dürfen nicht für kultische Zwecke verwendet werden“. Doch das ist höchstens eine buchhalterische Nuance und sicher keine wirkliche Einschränkung, denn „nicht für kultische Zwecke“ schliesst beispielsweise die Bezahlung von Pfarrerinnen und Pfarrern aus den Einnahmen der Kirchensteuern der juristischen Personen aus. Ohnehin sind aber nicht-kultische Budget-Posten wie Gebäudeunterhalt von beträchtlicher Grösse, so dass die Einschränkung „nicht für kultische Zwecke“ mehr oder weniger bedeutungslos ist.
Die Befreiung von der Kirchensteuerpflicht ist nur gegeben bei juristischen Personen, welche selber einen religiösen oder kirchlichen Zweck verfolgen. Um allen Firmen (juristischen Personen) eine Befreiung von der Kirchensteuerpflicht zu ermöglichen, wurde im Berner Kantonsparlament ein entsprechender politischer Vorstoss eingereicht.
Der zweite Standortvorteil der Berner Landeskirchen in Bezug auf die finanziellen Angelegenheiten ist die Pfarrstellen-Finanzierung durch den Kanton Bern. Der vorwiegend reformierte Kanton Bern bezahlt seine Geistlichen mit allgemeinen Steuergeldern. Dies erfolgte, nachdem er im Jahr 1804 die Kirchengüter eingezogen hatte. Im Grunde waren die kirchlichen Besitztümer zwar im wesentlichen von der Bevölkerung erarbeitet und mit Abgaben an den kirchlichen Klerus finanziert worden. Trotzdem verpflichtete man sich damals staatlicherseits künftig die Besoldung des Pfarrpersonals zu bezahlen und diese Regelung gilt bis heute.
So fliessen jährlich aus den kantonalen Steuereinnahmen über 70 Millionen Franken an die Berner Landeskirchen. Auch gegen diese Regelung regte sich Widerstand, da wie überall in der Schweiz die Landeskirchen die Steuerhoheit verliehen bekamen und somit von den Kirchenmitgliedern auf ihrem Hoheitsgebiet Steuern einziehen können und darüber hinaus wie im Kanton Bern auch noch von den Firmen Kirchensteuern einziehen können.
Um den Kritikerinnen und Kritikern der Pfarrschafts-Besoldung Wind aus den Segeln zu nehmen, änderte man das Kirchengesetz ab: In der Summe werden weiterhin 70 Millionen Franken an die Reformierte Kirche, die Römisch-katholische Kirche und die Christkatholische Kirche überwiesen, jedoch sind nun fix nur noch die als sogenannter Sockelbeitrag definieren 40 Millionen Franken. Die übrigen 30 Millionen Franken sind als leistungsbezogene Zahlung definiert. Periodisch sollen die erbrachten Leistungen bewertet werden und falls die gesellschaftliche Leistung der Kirchen sinken würde, dann würden auch diese 30 Millionen Franken etwas reduziert.
Korrelation Kirchenaustritte und Kirchensteuer
Beim Entscheid, aus der Kirche auszutreten oder nicht, spielt die Höhe der Kirchensteuern eine nicht unbedeutende Rolle. Kirchgemeinden mit einer tiefen Steuerbelastung verzeichnen weniger Austritte, wie eine Studie zeigt.
Kirchenmitglied bleiben? Oder austreten? Diese Frage stellt sich am ehesten dann, wenn die Kirchensteuern zu bezahlen sind oder die Steuererklärung ausgefüllt werden muss. Wenn nicht gerade Negativmeldungen wie dieses Jahr die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche die Schlagzeilen beherrschen, sind Kirchenaustritte aus Protest die Ausnahme.
In jedem Fall kann davon ausgegangen werden, dass es Austrittswillige nicht mehr für wert halten, die Kirchensteuern zu bezahlen. Mit Ausnahme der Kantone Genf, Neuenburg und Waadt ist in der Schweiz die Kirchenmitgliedschaft an die Kirchensteuerpflicht gebunden. Das Entfallen dieser Pflicht ist denn auch die direkteste Folge eines Austritts.